- info@darmsprechstunde.de
- 80111 München, Brienner Str. 13
- Privates Institut für Laser Proktologie seit 2012
Verhaltenstipps, Hausmittel, konservative und operative Therapie
Home » Behandlungsverfahren » Hämorrhoiden-Behandlung
Die American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS) berichtet, dass mehr als zwei Drittel der Bevölkerung irgendwann einmal Hämorrhoidenbeschwerden haben. In Deutschland geht man von 3,3 Millionen Behandlungsfällen pro Jahr aus. Der Markt für Medizinprodukte zur Hämorrhoidenchirurgie wächst in den USA jährlich um 5,6 % auf voraussichtlich 1,2 Mrd. $ im Jahr 2031 (TMR Inc. 2022). Etwa 2 – 3 % der Patienten, die mit Beschwerden zum Arzt gehen, werden operiert.
Hämorrhoiden können die Konzentration und das Selbstvertrauen bei der Arbeit ernsthaft beeinträchtigen, die Ausübung von Sport einschränken und zu einem unsicheren Körpergefühl führen. Die gute Nachricht ist, dass wir eine breite Palette wirksamer Therapien anbieten können. Wir helfen Ihnen, eine gute Entscheidung zu treffen, ob eine Operation sinnvoll und notwendig ist oder nicht. Jeder Eingriff will gut überlegt sein, denn wir haben kein „Ersatzteil“ für den Darmausgang.
In der Behandlung von Hämorrhoiden hat in den letzten Jahrzehnten ein deutliches Umdenken stattgefunden. Heute gelten Hämorrhoiden nicht mehr als krankhafte Wucherungen, sondern als natürlicher und wichtiger Bestandteil des Kontinenzorgans – jener feinen anatomischen Strukturen, die den Enddarm abdichten und so zur Kontrolle des Stuhlgangs beitragen. Dieses empfindliche Gewebe erfüllt also eine wesentliche Funktion – und ist es wert, erhalten zu werden, statt es vorschnell zu entfernen.
Die aktuelle Expertenleitlinie stellt die gängigen Behandlungsmethoden auch für Laien weitgehend verständlich und evidenzbasiert bewertet dar, eine vergleichende Übersicht der Leitlinien in Europa und den USA finden Sie hier.

Und wie sieht die optimale Behandlung aus?
Wichtig zu wissen:
Die wichtigsten Kriterien sind neben dem Stadium der Hämorrhoiden das Leitsymptom (Blutung, Druckgefühl, Nässen) und das Ausmaß der subjektiven Beeinträchtigung. Wichtig ist auch, ob und wie lange konservative Behandlungsmaßnahmen in der Vergangenheit geholfen haben und ob der Verdacht auf eine bösartige Veränderung der Haut oder Schleimhaut besteht.
Die Leitlinien der Fachgesellschaften finden Sie hier:
Ziel ist ein geformter, nicht zu harter Stuhl. Viele Patienten versuchen bei Schmerzen, den Stuhl möglichst weich zu halten. Klingt logisch, ist aber ein Trugschluss: Zu weicher Stuhl bleibt länger auf der Haut, dringt in kleine Wunden oder Schleimhautnischen ein und kann dadurch Entzündungen fördern. Außerdem lässt er sich schlechter kontrollieren (Stichwort: „Stuhlschmieren“) und löst weniger Entleerungsreiz aus – was wiederum zu Störungen beim Stuhlgang führen kann.
Was hilft konkret?
Ballaststoffe & Quellmittel: Besonders Flohsamenschalen (Psyllium) sind ein echter Geheimtipp. Zwei Teelöffel in ein Glas kaltes Wasser einrühren, auf ex trinken – und schon wird der Stuhl bei den meisten Menschen geformter, der Toilettengang leichter und das Pressen geringer. Selbst der Verbrauch an Toilettenpapier sinkt oft merklich.
Osmotische Regulanzien: Macrogol macht den Stuhl weicher, ohne vom Körper aufgenommen zu werden, und ist auch für die Langzeitanwendung geeignet. Lactulose funktioniert ähnlich, kann aber bei manchen Blähungen auslösen.
Probiotika: Helfen, das Darmmikrobiom zu stabilisieren. Welche Mischung am besten wirkt, muss man meist ausprobieren.
Trinken: Meist reicht es, sich am Durst zu orientieren. Aber: Im Alltag oder bei Hitze vergisst man leicht, genug zu trinken – achten Sie bewusst darauf.
Nahrungsmittelunverträglichkeiten: Lactose, Fructose, Gluten oder Histamin können Probleme machen. Ein Ernährungstagebuch oder eine Abklärung beim Gastroenterologen bringt hier Klarheit.
So schaffen Sie die besten Voraussetzungen für einen regelmäßigen, problemlosen Stuhlgang – und damit auch für weniger Beschwerden im Analbereich.


Gehen Sie nur dann auf die Toilette, wenn wirklich ein Drang besteht – nicht „auf Vorrat“. Hören Sie auf die Signale Ihres Körpers. Nehmen Sie sich dabei genügend Zeit: Stress und Eile aktivieren das sympathische Nervensystem und bremsen die Darmtätigkeit.
Vermeiden Sie starkes Pressen. Ein leichter Druck zu Beginn ist erlaubt, aber extremes Pressen schadet den Hämorrhoiden. Besser ist es, die natürlichen Reflexe zu nutzen: Wenn sich der Magen füllt, reagiert auch der Darm. Ein großes Glas Wasser gleich nach dem Aufstehen verstärkt diesen Reflex und erleichtert die morgendliche Entleerung, bevor Sie in den Alltag starten.
Auch die Sitzhaltung spielt eine Rolle. Moderne Toiletten sind bequem, aber nicht optimal für die Darmentleerung – der anorektale Winkel ist ungünstig. Ein kleiner Hocker unter den Füßen bringt den Körper in die natürliche Hockstellung und macht das Geschäft deutlich leichter.
Lesen Sie Zeitung oder Handy lieber am Frühstückstisch – nicht auf der Toilette. Langes Sitzen erhöht den Druck im Hämorrhoidenkreislauf und verschlimmert Beschwerden.
Für die Hygiene gilt: Besser angefeuchtete Wattepads aus der Drogerie verwenden als feuchtes Toilettenpapier, das Allergien auslösen kann. Zur Pflege eignen sich natürliche Mittel wie Ringelblumensalbe, Zinksalbe oder Bäder mit Eichenrindenextrakt.
Diese am häufigsten durchgeführte Behandlung ohne Operation hat das Ziel einer Straffung und Stabilisierung des Bindegewebes. Bei der sogenannten Verödung (Sklerosierung) wird in den Bereich der zu den Hämorrhoiden führenden Gefäße (Methode nach Blanchard) oder wie in Europa bevorzugt unmittelbar unter die Schleimhaut (Methode nach Blond) ein Medikament eingespritzt, das zur narbigen Fixation und Schrumpfung der Hämorrhoidalknoten führt. Diese Maßnahme kann schmerzfrei ambulant durchgeführt werden und wird daher sehr häufig angewendet. Sie muss in der Regel mehrfach im Abstand von einigen Wochen wiederholt werden. Bis die Beschwerden ganz verschwunden sind, können einige Monate vergehen. Kurzfristig im Rahmen von Monaten hilft die Verödungsbehandlung 70 – 85 %, langfristig knapp 30 % der Patienten.
Komplikationen sind bei der oberflächlichen Injektionstechnik kleiner Volumina extrem selten. Schwerwiegende Gewebsschädigungen waren bei den früher verwendeten Phenol-Öl-Mischungen berichtet worden, das heute verwendete Verödungsmittel (Polidocanol, Äthoxysklerol®) ist risikoarm und in der Regel sehr gut verträglich. Bei entzündlichen Darmerkrankungen und in der Schwangerschaft sollte man dennoch auf eine Sklerotherapie verzichten.
Viele Patienten hoffen, Hämorrhoiden mit Salben, Zäpfchen oder Cremes dauerhaft in den Griff zu bekommen. Diese Präparate können allerdings nur die Beschwerden lindern, nicht aber die eigentliche Ursache beseitigen – nämlich die Vergrößerung und Instabilität der Hämorrhoidenpolster.
Hamamelis (Zaubernuss) wirkt leicht entzündungshemmend und abschwellend, hilft also kurzfristig bei Brennen oder Juckreiz.
Die mikronisierte, gereinigte Flavonoid-Fraktion (MPFF, Daflon®) ist ein pflanzliches Wirkstoffgemisch, das hauptsächlich aus Diosmin (ca. 90 %) und Hesperidin (ca. 10 %) besteht. Diese Flavonoide stammen aus Zitrusfrüchten. Sie stabilisieren die Gefäßwände und reduzieren die Durchlässigkeit der Kapillaren, vermindern Flüssigkeitsaustritt und Schwellung, hemmen Entzündungsmediatoren und fördern den Lymphabfluss und Mikrozirkulation. In Studien haben sie sich als wahrscheinlich wirksam zur Reduktion von akuten Schwellungszuständen und Schmerzen nach Operationen erwiesen, in bis zu 76 % zur Symptomlinderung bei Frühstadien von Hämorrhoiden.
Kortisonhaltige Präparate können bei akuten Entzündungen und Ekzemen im Analbereich kurzfristig sehr effektiv sein – sollten jedoch nicht über längere Zeit verwendet werden, da sie die Haut dünner und empfindlicher machen.
Dapsonhaltige Salben, die gelegentlich off-label eingesetzt werden, können bei chronischen Entzündungszuständen hilfreich sein, sollten aber nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden.
Daneben existieren zahlreiche „Wund- und Heilsalben“, pflanzliche Kombinationspräparate oder Venentonika, deren Nutzen wissenschaftlich nur unzureichend belegt ist. Sie sind meist nicht schädlich, führen aber oft zu einer Verzögerung der notwendigen Behandlung, wenn sie als alleinige Therapie verwendet werden.
Kurz gesagt: Salben und Zäpfchen können Symptome bessern, aber keine Hämorrhoiden heilen. Wenn Beschwerden über Wochen bestehen bleiben, ist eine proktologische Abklärung immer der richtige nächste Schritt.

Bei der Gummibandligatur wird überschüssige Schleimhaut mit einem Gummiring abgeschnürt, das Gewebe stößt sich nach ein bis zwei Wochen von selbst ab. Dadurch werden die Hämorrhoiden verkleinert und durch Vernarbung wieder an der natürlichen Position fixiert. Diese Maßnahme darf ebenfalls keine Schmerzen verursachen, sonst muss eine andere Behandlungsmethode gewählt werden.
Wie die Sklerotherapie kann die GBL ambulant in wenigen Minuten durchgeführt werden. Eine örtliche Betäubung ist möglich, aber meist nicht nötig. Pro Behandlung werden ein bis zwei Gummibänder gesetzt. Die Behandlung ist grundsätzlich wiederholbar, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht ist. Die Leitlinie empfiehlt die Gummibandligatur als Methode der Wahl für Hämorrhoiden II°.
Blutungen oder Nachblutungen sind Risiken, insbesondere, wenn Sie blutverdünnende Medikamente einnehmen. Das abgebundene Gewebe kann bis zur Abstoßung als unangenehm empfunden werden, sodass es sich empfiehlt, in einer Behandlungssitzung nicht mehr als ein bis zwei Bänder zu setzen.
Bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) sowie mit geschwächtem Immunsystem oder bei einer Latex-Allergie soll eine Ligaturbehandung nicht durchgeführt werden.
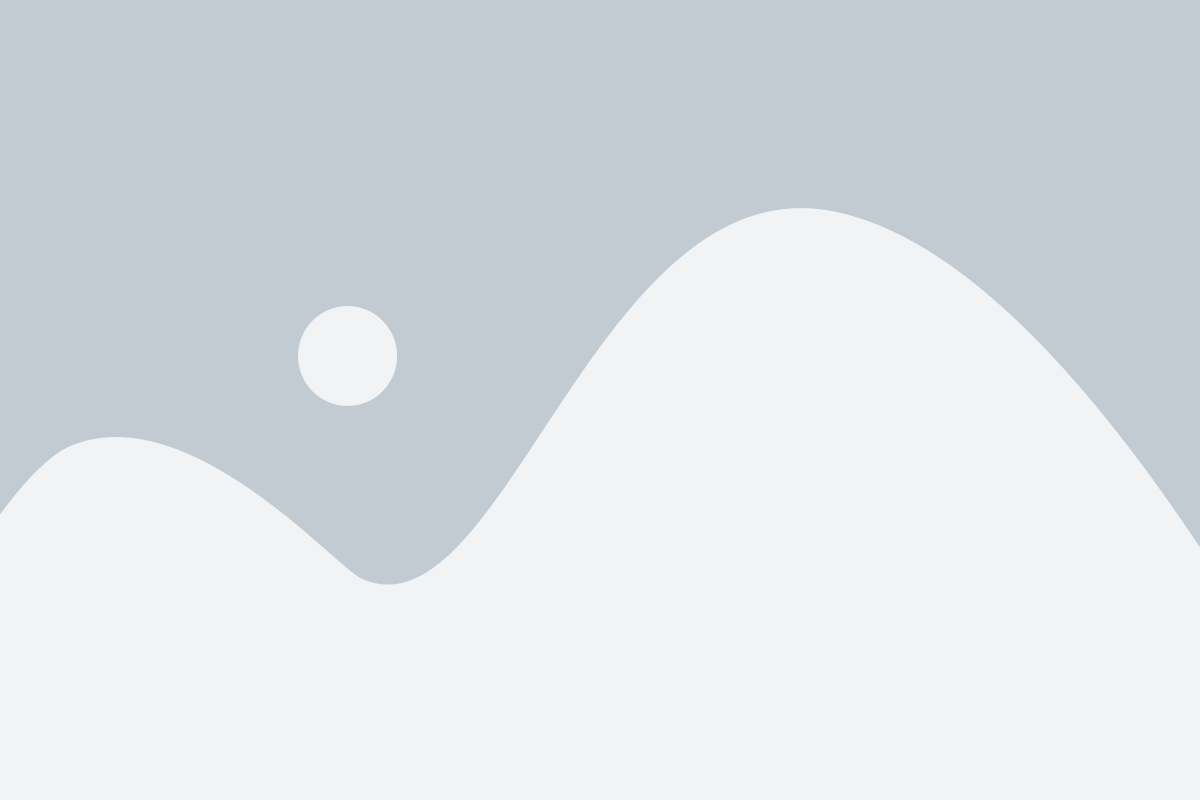
Die Hämorrhoiden Entfernung durch einen operativen Eingriff heißt in der Fachsprache Hämorrhoidektomie. Dabei umschneidet der Operateur den äußeren Anteil bogenförmig und löst die vergrößerte Hämorrhoide vom inneren Schließmuskel. Eine – auflösbare – Naht unterbindet die zentralen, zuführenden Blutgefäße. Die Wunde kann offen bleiben (Milligan-Morgan), fortlaufend vernäht (Ferguson) oder rekonstruktiv geschlossen werden (Parks, jeweils nach dem Erstbeschreiber der Technik). Die meisten Chirurgen verwenden ein Elektroskalpell (Diathermie). Alternativen können Versiegelungs-Instrumente (z.B. Ultracision®, Ligasure®) oder auch ein Operationslaser sein.

Die Hämorrhoidektomie ist zu diskutieren, wenn konservative Behandlungen oder hämorrhoidenerhaltende Verfahren wie Laser- oder Radiofrequenztherapie nicht ausreichen, oder wenn Hämorrhoiden stark vorgefallen (Grad IV) und nicht mehr zurückführbar sind.
Die traditionellen Operationsmethoden noch einmal zusammengefaßt:dd
die offene Hämorrhoidektomie nach Milligan-Morgan,
die halboffene Methode nach Ferguson und
die rekonstruktive Operation nach Parks
haben sich über Jahrzehnte als dauerhafte und bewährte Verfahren etabliert. Schließlich gilt: Was vollständig entfernt ist, kann nicht wiederkommen.
Die Wunden sind meist größer, die Heilung dauert länger, und nicht immer bleibt die feine Schließfunktion des Afters vollständig erhalten – denn die Hämorrhoidalpolster wirken im gesunden Zustand wie ein natürlicher Dichtungsring für die Feinkontinenz. Die Hämorrhoiden-Entfernung kann auch mit dem Laser durchgeführt werden (Laser-Hämorrhoidektomie) mit leichten Vorteilen gegenüber der elektrochirurgischen Operation. Der Laser ist dabei ein etwas präziseres Werkzeug mit besserer Gewebsschonung, ein gänzlich anderes Therapieprinzp ist das nicht.
Zudem ist für diese Eingriffe fast immer ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus notwendig, eine Behandlung in unserem ambulanten Setting nicht verantwortungsvoll möglich. Heute kommen solche klassischen Operationen daher vor allem bei sehr ausgeprägten oder wiederkehrenden Befunden zum Einsatz.
In allen anderen Fällen bieten moderne, minimalinvasive Verfahren eine gleichwertig wirksame, aber deutlich schonendere und schnellere Alternative.
Soll man Hautfalten (Marisken) und Analvenenthrombosen operativ entfernen?
Bis zum dritten Stadium haben sich eine Reihe von Verfahren etabliert, bei denen die vergrößerten Gefäßpolster nicht durch operative Abtragung, sondern durch innere Fixation und Verödung der Hämorrhoiden durch Laser oder Radiofrequenz Energie behandelt werden.

Die RAFAELO®-Methode ist eine moderne, minimal-invasive Behandlung von Hämorrhoiden der Grade I–III. Dabei wird über eine feine Sonde gezielte Wärmeenergie (Radiofrequenz) in das Hämorrhoidalgewebe abgegeben. Die Wärme bewirkt eine sanfte Verödung und Schrumpfung der erweiterten Gefäßpolster – ohne Schneiden, Nähen oder offene Wunden.
Der Eingriff erfolgt ambulant und unter örtlicher Betäubung, dauert meist nur etwa 20 Minuten und wird von den meisten Patienten sehr gut vertragen. Studien zeigen:
Deutlich weniger Schmerzen als bei klassischen Operationen.
Schnelle Rückkehr in den Alltag, oft bereits nach 1–2 Tagen.
Sehr hohe Zufriedenheit: In Untersuchungen bewerteten Patient:innen das Ergebnis im Durchschnitt mit 9 von 10 Punkten, rund 95 % würden die Behandlung weiterempfehlen.
Auch das Risiko für Rückfälle ist gering, und Komplikationen treten nur selten auf. Damit bietet die RAFAELO®-Methode eine sanfte und effektive Alternative zur herkömmlichen Hämorrhoidenoperation – besonders für Menschen, die eine schonende, aber nachhaltige Behandlung wünschen.

Die Hämorrhoiden-Arterien-Ligatur (HAL), ursprünglich vom japanischen Chirurgen Morinaga entwickelt, basiert auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Prinzip: Die zuführenden Arterien der Hämorrhoiden werden mit Hilfe einer speziellen Doppler-Ultraschallsonde (Doppler-guided DG-HAL) aufgespürt und mit resorbierbarem Nahtmaterial unterbunden. Dadurch wird die Blutzufuhr gedrosselt, und die Hämorrhoidenpolster können sich nach und nach auf ihre normale Größe zurückbilden.
In Studien zeigte sich, dass die präzise Platzierung der Nähte oft ebenso zuverlässig – oder sogar besser – durch direkte Sichtkontrolle eines erfahrenen Proktologen erfolgen kann. Deshalb wird das Verfahren heute von vielen Operateuren auch ohne Doppler-Unterstützung angewendet, wobei das Grundprinzip unverändert bleibt.
Wird die Naht spiralförmig nach oben fortgeführt, entsteht eine sogenannte Raffnaht (rekto-anale Rekonstruktion, RAR). Diese hebt das Gewebe sanft an und fixiert es wieder an seiner ursprünglichen Position im Analkanal. Die Kombination beider Verfahren ist unter den Bezeichnungen HAL-RAR (Fa. A.M.I.®) oder Transanale Hämorrhoiden-Dearterialisation (THD® S.p.A.) bekannt.
In unserer Praxis führen wir diese Behandlung aus Gründen der Patientensicherheit, Übersicht und Präzision in Vollnarkose durch. Wir kombinieren diese Technik häufig mit der Laserbehandlung (LHP®). Der Laser sorgt zusätzlich von innen für eine präzise Verödung und Schrumpfung des Gewebes. Diese Kombination aus HAL und Laser ist gewissermaßen „Gürtel und Hosenträger“ in einem: Sie verbindet mechanische Stabilität mit zusätzlicher Sicherheit durch thermische Wirkung – für ein besonders zuverlässiges und schonendes Ergebnis.

Die Longo-Operation, auch bekannt als Stapler-Hämorrhoidopexie, ist ein modernes Verfahren zur Behandlung von fortgeschrittenen Hämorrhoiden, bei dem das vergrößerte Gewebe nicht entfernt, sondern in seine ursprüngliche Position zurückgeführt und fixiert wird.
Mit einem speziellen Klammerinstrument („Stapler“) wird ein ringförmiger Streifen Schleimhaut oberhalb des Hämorrhoidenkranzes entfernt. Gleichzeitig werden die Schnittränder automatisch mit feinen Titan-Klammern verschlossen. Dadurch wird einerseits der Blutfluss zu den Hämorrhoiden reduziert, andererseits das vorfallende Gewebe (Prolaps) sanft nach innen gezogen und stabilisiert. Die Klammern heilen im Gewebe ein oder werden nach einiger Zeit von selbst abgestoßen.
Die Methode gilt als relativ schmerzarm, die Operationszeit ist kurz, und die Erholungsphase meist deutlich schneller als nach herkömmlichen Eingriffen.
Die Technik hat ihre Wurzeln in den 1980er-Jahren: Die kasachischen Chirurgen S. N. Koblandin und J. L. Schalkow beschrieben erstmals das Prinzip einer zirkulären Schleimhautresektion mit Klammernaht. Der italienische Chirurg Antonio Longo griff diese Idee Anfang der 1990er Jahre auf, verfeinerte sie mithilfe moderner Staplergeräte und machte das Verfahren unter dem Namen Stapler-Hämorrhoidopexie (Longo-Methode) international bekannt.
Trotz der überzeugenden Vorteile – kurze Operationszeit, geringe Schmerzen, schnelle Rekonvaleszenz – ist das Verfahren nicht frei von Risiken. In seltenen Fällen kann es zu Nahtinsuffizienzen (Aufreißen der Klammernaht im Darm) oder einem Urge-Syndrom (ständiger Stuhldrang oder Druckgefühl) kommen.
Wir empfehlen die Longo-Operation daher nur in besonderen Einzelfällen und führen sie selbst nicht mehr durch.
Nein.
Die meisten Hämorrhoidenbeschwerden lassen sich mit konservativen Maßnahmen erfolgreich behandeln – etwa durch eine ballaststoffreiche Ernährung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, eine regulierte Darmtätigkeit sowie lokal wirksame Salben oder Sitzbäder.
Erst wenn diese Maßnahmen keine ausreichende Besserung mehr bringen, zusätzliche Befunde wie eine chronische Analfissur bestehen oder sich aufgrund des klinischen Erscheinungsbildes ein Verdacht auf bösartige Veränderungen ergibt, ist eine operative Behandlung erforderlich.
Neben der klassischen Operation stehen heute mehrere minimalinvasive Verfahren zur Verfügung. Dazu gehören die Gummibandligatur, die Sklerosierung (Verödung), die Laserbehandlung (LHP®), die Radiofrequenz-Therapie (RAFAELO®) sowie gefäßunterbindende Verfahren wie HAL-RAR.
Diese Methoden zielen darauf ab, die Hämorrhoiden zu verkleinern, zu stabilisieren oder zu veröden – meist mit deutlich weniger Schmerzen und schnellerer Erholung als bei herkömmlichen Operationen.
Wie bei jedem Eingriff kann es auch nach einer Hämorrhoidenoperation in Einzelfällen zu Komplikationen kommen. Am häufigsten sind leichte Nachblutungen in den ersten zwei Wochen – sie sind meist unbedenklich und hören von selbst wieder auf. Sehr selten treten Infektionen, Entzündungen oder eine verzögerte Wundheilung auf, die sich über Wochen bis Monate hinziehen kann.
Bei klassischen Operationsmethoden kann es zu Funktionsstörungen des Schließmuskels kommen – zum Beispiel einem Stuhlschmieren (Soiling) oder Schwierigkeiten beim Zurückhalten von Darmgasen. Nach modernen, minimalinvasiven Verfahren ist das jedoch sehr selten. Manche Patienten verspüren ein Fremd- oder Druckgefühl, das meist innerhalb weniger Wochen vollständig abklingt.
Insgesamt sind Komplikationen nach Hämorrhoidenoperationen selten, aber nicht auszuschließen, so daß die Entscheidung für eine Operation bzw. ein Operationsverfahren wohlüberlegt sein will.
Die Heilungszeit hängt stark vom gewählten Verfahren und dem individuellen Befund ab. Nach minimalinvasiven Eingriffen wie Laser- oder Radiofrequenzbehandlung sind Patienten meist nach 1 – 2 Wochen wieder arbeitsfähig. Nach einer klassischen Hämorrhoidektomie kann die Ausfallszeit hingegen bis vier Wochen dauern, bis alle Beschwerden vollständig abgeklungen sind können Monate vergehen.
Dank moderner Anästhesie und minimalinvasiver Techniken sind die Schmerzen nach einer Hämorrhoidenbehandlung heute deutlich geringer als früher. Es kann zu einem Brennen, Druckgefühl oder Schmerzen beim Stuhlgang kommen, die mit Schmerzmitteln, lokalanästhetischen Salben und Gelen, Sitzbädern und stuhlregulierenden Maßnahmen behandelt werden. Nach konventioneller Hämorrhoidenoperation benötigen die Patienten regelhaft eine kombinierte Schmerztherapie aus peripher und zentral wirksamen Schmerzmitteln.
Nach schonenden Verfahren wie Laser oder HAL-RAR ist eine Rückkehr in den Alltag und an den Arbeitsplatz meist nach 1 – 2 Wochen möglich.
Nach größeren Eingriffen sollte eine Schonzeit von 2 – 3 Wochen eingeplant werden. Körperliche Aktivität nach Schmerzmaßgabe ist ausdrücklich erwünscht, intensiver Sport sollte jedoch erst nach Rücksprache mit dem Arzt wieder aufgenommen werden.
Ein Rückfall (Rezidiv) lässt sich nach einer Hämorrhoidenbehandlung nie ganz ausschließen. Das Risiko hängt maßgeblich vom Verhalten nach dem Eingriff ab – insbesondere von einer ballaststoffreichen Ernährung, ausreichender Flüssigkeitszufuhr, guter Analhygiene und dem Vermeiden von starkem Pressen beim Stuhlgang.
Bei sogenannten Fixationsverfahren (z. B. HAL-RAR, Longo) kann in den ersten drei Jahren bei etwa 20 % der Patienten erneut eine Vergrößerung oder ein Vorfall auftreten. Nach einer klassischen Ausschneidung (Hämorrhoidektomie) ist die Rückfallrate deutlich geringer, da das betroffene Gewebe vollständig entfernt wird. Eine einmal entfernte Hämorrhoide wächst nicht nach – im positiven wie auch im negativen Sinn: Der Befund bleibt stabil, aber das natürliche Polster fehlt dauerhaft.
Bleibt nach Abschluss der Wundheilung eine leichte Undichtigkeit (z. B. Stuhlschmieren) bestehen, bessert sich diese in der Regel nicht mehr wesentlich. Deshalb ist die Wahl des geeigneten Verfahrens entscheidend, um ein gutes funktionelles Ergebnis zu sichern.
Nicht zwingend. Die meisten modernen Verfahren – etwa Lasertherapie, Radiofrequenz oder HAL-RAR – können ambulant in örtlicher Betäubung oder kurzer Vollnarkose durchgeführt werden. Nur bei sehr großen Befunden oder Begleiterkrankungen und Risiken oder fehlender häuslicher Versorgung ist ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus erforderlich.
Vor dem Eingriff sollten Sie alle Medikamente (insbesondere blutverdünnende Mittel) mit Ihrem Arzt besprechen. Wir empfehlen, den Darm am Vortag oder Morgen des Operationstags zu entleeren, z.B. mit Microlax® oder Lecicarbon®. Eine Spülung wie bei großen Darmoperationen ist eher kontraproduktiv.
Am Operationstag ist es notwenig, nüchtern zu erscheinen und einen Abholer zu organisieren. Eine gute Hautpflege und die Vermeidung von Reizstoffen im Analbereich helfen, die Wundheilung nach der OP zu unterstützen.
In der Regel ja – sobald Sie im wesentlichen schmerzfrei und mobil sind. Kurze Flüge sind meist schon nach wenigen Tagen, längere Reisen nach ein bis zwei Wochen möglich. Wichtig ist, während der Reise ausreichend zu trinken, Bewegungspausen einzulegen und starkes Pressen zu vermeiden. Bei Unsicherheit sollten Sie vorab mit Ihrem behandelnden Arzt Rücksprache halten.
Nein – Medikamente, Salben und Zäpfchen können Beschwerden wie Jucken, Brennen oder Nässen lindern, aber sie heilen Hämorrhoiden nicht dauerhaft. Präparate mit Hamamelis oder Cortison helfen kurzfristig gegen Entzündung und Schwellung, sollten jedoch nicht langfristig angewendet werden. Wenn die Beschwerden trotz solcher Mittel bestehen bleiben, ist eine proktologische Untersuchung sinnvoll, um gezielt zu behandeln statt nur zu überdecken.
Alvandipour, M., Ala, S., Tavakoli, H., Yazdani Charati, J., & Shiva, A. (2016). Efficacy of 10% sucralfate ointment after anal fistulotomy: A prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. International Journal of Surgery,
Amaturo, A., Meucci, M., & Mari, F. (2020). Treatment of haemorrhoidal disease with micronized purified flavonoid fraction and sucralfate ointment. Acta Bio Medica : Atenei Parmensis, 91(1), 139-141.
Aziz, Z., Kit Huin, W., Badrul Hisham, M., Ling Tang, W., & Yaacob., S. (2018). Efficacy and tolerability of micronized purified flavonoid fractions (MPFF) for haemorrhoids: A systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine,
Davis, B. R., Lee-Kong, S. A., Migaly, J., Feingold, D. L., & Steele, S. R. (2018). The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Hemorrhoids. Diseases of the colon and rectum, 61(3), 284–292.
Caetano, A., Cunha, C., Arroja, B., Costa, D., & Rolanda, C. (2019). Role of a Micronized Purified Flavonoid Fraction as an Adjuvant Treatment to Rubber Band Ligation for the Treatment of Patients With Hemorrhoidal Disease: A Longitudinal Cohort Study. Annals of Coloproctology, 35(6), 306-312.
Furtwängler, A. (2020). Sklerosierungstherapie. coloproctology, 42(1), 14-17.
Gupta, P., Heda, P., Kalaskar, S., & Tamaskar, V. (2007). Topical Sucralfate Decreases Pain After Hemorrhoidectomy and Improves Healing: A Randomized, Blinded, Controlled Study. Diseases of the Colon & Rectum, 51(2), 231-234.
Jacobs, D. (2018). Hemorrhoids: what are the options in 2018?. Current Opinion in Gastroenterology, 34(1), 46-49.
Muldoon R. (2020). Review of American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Hemorrhoids. JAMA surgery, 155(8), 773–774.
de Parades, V., Aubert, M., Fathallah, N., Alam, A., Spindler, L., & Benfredj, P. (2022). The comeback of hemorrhoidal sclerotherapy?. Techniques in Coloproctology, 26(8), 599-601.
Perrotti, P., Antropoli, C., Molino, D., Stefano, G., & Antropoli, M. (2005). Conservative treatment of acute thrombosed external hemorrhoids with topical nifedipine. Diseases of the Colon & Rectum, 44(3), 405-409.
Ashburn, J. (2025). Hemorrhoidal Disease. JAMA, 334(17)
Petersen, S., Holch, P., & Jongen, J. (2020). Leitlinien zur Behandlung des Hämorrhoidalleidens. coloproctology, 42(1), 6-13.
Raulf, F., Wienert, V., & Mlitz, H. (2012). Das Hämorrhoidalleiden. coloproctology, 34(4), 303-315.
Schmuck, R., & Roblick, M. (2025). Incidence, Diagnosis, and Management of Proctological Conditions during Pregnancy. Visceral Medicine, OnlineFirst, 1-7.
Takano, M., Iwadare, J., Ohba, H., Takamura, H., Masuda, Y., Matsuo, K., Kanai, T., Ieda, H., Hattori, Y., Kurata, S., Koganezawa, S., Hamano, K., & Tsuchiya, S. (2005). Sclerosing therapy of internal hemorrhoids with a novel sclerosing agent. International Journal of Colorectal Disease, 21(1), 44-51.
Tol, R., Kleijnen, J., Watson, A., Jongen, J., Altomare, D., Qvist, N., Higuero, T., Muris, J., Breukink, S., & Henquet, C. (2020). European Society of ColoProctology: guideline for haemorrhoidal disease. Colorectal Disease, 22(6), 650-662.
Trompetto, M., Clerico, G., Cocorullo, G. F., Giordano, P., Marino, F., Martellucci, J., Milito, G., Mistrangelo, M., & Ratto, C. (2015). Evaluation and management of hemorrhoids: Italian society of colorectal surgery (SICCR) consensus statement. Techniques in coloproctology, 19(10), 567–575.
Zagriadskiĭ, E., Bogomazov, A., & Golovko, E. (2018). Conservative Treatment of Hemorrhoids: Results of an Observational Multicenter Study. Advances in Therapy, 35(11), 1979-1992.